Fragen & Antworten
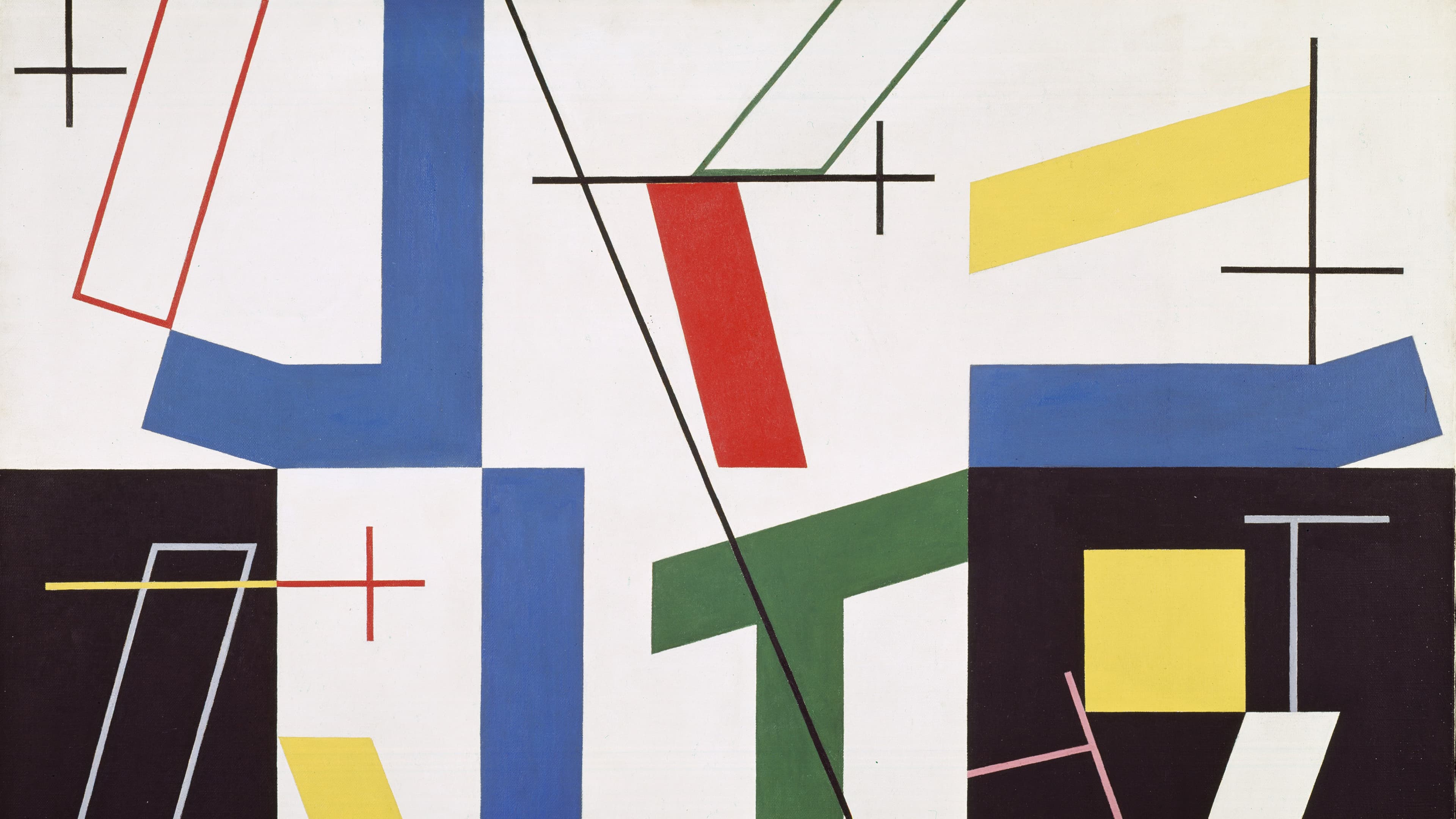
Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Projekt «Zukunft Kunstmuseum Bern».
Gründe für ein neues Museum
Die beiden Museumsgebäude – der Stettlerbau von 1879 und der Erweiterungsbau von 1983 (Atelier 5-Bau) – müssen dringend saniert werden. Es bestehen gravierende Mängel hinsichtlich Haus- und Klimatechnik, Tragkonstruktion (Erdbebensicherheit), Barrierefreiheit, Kunstanlieferung und -logistik, Beleuchtung, Sicherheits- und Fluchtwege sowie des langfristigen Kulturgüterschutzes (Kunstdepot). Der Atelier 5-Bau darf aus statischen Gründen nur bis Ende 2030 betrieben werden. Die zeitnahe Sanierung des Stettlerbaus ist nötig, weil die Gebäudetechnik bereits über 25 Jahre alt ist und bei einem weiteren Aufschub sich das Risiko von ungeplanten Betriebsunterbrüchen erhöht und zu höheren Kosten für die Sicherstellung der Gebäudetechnik führt.
Laut einer 2019 publizierten Machbarkeitsstudie bietet ein Ersatzneubau für den Atelier 5-Bau – anstelle einer aufwändigen Sanierung – mit gleichzeitigem Einbezug des Gebäudes Hodlerstrasse 6 die beste Lösung für die Museumserneuerung. Im Vordergrund steht nicht die Vergrösserung der Ausstellungsfläche, sondern ein überzeugendes Gesamtkonzept, das einen effizienten und ressourcenschonenden Museumsbetrieb mit attraktiven Angeboten ermöglicht. So muss das Kunstmuseum im Ersatzneubau keine teuren Büroflächen bauen und gewinnt auch Platz mit der Auslagerung des Bistros.
Der Ersatzneubau ermöglicht es dem Kunstmuseum, besucher:innenfreundliche Ausstellungsräume und Depoträume nach zeitgemässen Standards zu realisieren, sich zur Stadt und zum Aarehang zu öffnen und neue Kunsterlebnisse zu bieten. Mit dem sanierten Stettlerbau, der Ergänzung durch das Bürogebäude Hodlerstrasse 6 und dem Ersatzneubau kann das Kunstmuseum seinen Auftrag erfüllen und den Schutz, die Pflege und die Vermittlung der ihm anvertrauten hochkarätigen Kulturgüter auch in Zukunft sicherstellen. Das Kunstmuseum wird sich als kultureller Leuchtturm im Kanton Bern nachhaltig und zukunftsorientiert weiterentwickeln.
Das Kunstmuseum Bern des 21. Jahrhunderts stellt die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum: Ein einladender offener Zugang zum Gebäude ist dafür ebenso wichtig wie attraktive Vermittlungsräume, barrierefreie Zugänge, ein ausreichendes Gastronomieangebot und Orte, wo man reflektieren, sich treffen und sich austauschen kann. Mit der Erneuerung kann das Kunstmuseum internationale Standards in Bezug auf Ausstellungsklima, Sicherheit, Kulturgüterschutz, Kunstanlieferung, Barrierefreiheit, Servicequalität und Besucherfreundlichkeit erfüllen.
Dank seiner Sammlungen und Ausstellungsprogramme stösst das Kunstmuseum Bern bei Bevölkerung und Medien auf grosse Resonanz, national und international wird es als eine renommierte Adresse für die Erforschung und Vermittlung von Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart wahrgenommen. Das Museum zählt pro Jahr durchschnittlich 100’000 Besuchende. Was dem Kunstmuseum fehlt, ist eine zeitgemässe, nachhaltige Infrastruktur. Mit besser geeigneten Ausstellungsräumen und moderner Infrastruktur kann das Museum seine Stärken wirksamer ausspielen, die Bevölkerung noch besser ansprechen und seine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit fortführen.
Über Generationen ist das Kunstmuseum zur Bildungs- und Kulturstätte des Kantons Bern geworden, besucht von Erwachsenen, Familien, Kindern, Schulen und Firmen. Der Vermittlung und Bildung kommt eine Schlüsselrolle zu. 2024 fanden zum Beispiel 164 Führungen und Workshops für Schulklassen statt, Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen zu den Sonderausstellungen, geführte Rundgänge für Studierende der Pädagogischen Hochschule PH Bern und des PH-Instituts NMS und 246 Gruppenbesuche von Volks- und Mittelschulen sowie Fach- und Hochschulen.
Was dem Kunstmuseum fehlt, ist eine zeitgemässe, nachhaltige Infrastruktur. Mit besser geeigneten Ausstellungsräumen und moderner Infrastruktur kann das Museum seine Stärken wirksamer ausspielen, die Bevölkerung noch besser ansprechen und seine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit fortführen.
Kunsterlebnis und Publikum
Dank sanfter Übergänge von der Strasse ins Gebäude ist das erneuerte Museum leicht zugänglich und barrierefrei. Der von aussen gut sichtbare Eingang und die Foyerzone empfangen die Besucher:innen mit einer einladenden Geste. Die neuen offenen und lichten Ausstellungsräume bieten die nötigen Rahmenbedingungen für ein zeitgemässes Kunsterlebnis. Die Kunstvermittlung erhält attraktive Räume für ihre vielfältigen Angebote und direkten Zugang zur neu geschaffenen Aareterrasse. Die Gastronomie ist neu auch ausserhalb der Öffnungszeiten der Ausstellungen zugänglich. Nichtkommerzielle Aufenthaltszonen und ein moderner Veranstaltungsraum machen das Kunstmuseum zum inklusiven, öffentlichen Ort der Begegnung und des Austauschs.
In den neuen Räumlichkeiten können dank ihrer Grösse, Flexibilität, Höhe und den Lichtverhältnissen sowie höheren Traglasten alle künstlerischen Medien ohne Einschränkung nebeneinander gezeigt werden: Arbeiten auf Papier neben Skulpturen, Gemälden, Installationen oder Videos. Zudem will das Museum neue Wege der Vermittlung einschlagen: Analoge und digitale Kunstvermittlung verschränken sich in neuen Formaten und erlauben neue Zugänge zur Kunst. Im Bereich Kunstvermittlung sind grössere und attraktivere Ateliers mit Bezug zum Aussenraum geplant. Geplant ist zudem ein Raum, in dem Restaurierungsprojekte für die Öffentlichkeit sichtbar werden. Dort geht es darum, bestehende Aktivitäten, die bislang hinter den Kulissen stattfinden, einem breitem Publikum zeigen zu können. Des Weiteren ist geplant, auch die Aktivitäten der Abteilung Provenienzforschung in einem Raum dauerhaft sichtbar zu machen.
Es sollen gezielt Gruppen in Programme eingebunden werden, die das Museum heute noch nicht in selbstverständlicher Weise nutzen. Das Kunstmuseum Bern versteht sich als Teil der inklusiven Gesellschaft, in welcher alle Menschen willkommen sind. Interaktive Formate und Möglichkeiten der Teilhabe sind Voraussetzung dafür und sollen in der Vermittlungsarbeit verstärkt eine wichtige Rolle spielen.
Ein Museumsbesuch ist ein Gesamterlebnis. Deshalb ist ein ausreichendes Gastro-Angebot geplant, mit dem sich auch ausserhalb der Öffnungszeiten und getrennt vom Museumsbetrieb Anlässe durchführen lassen. Das Siegerprojekt «Eiger» sieht das ebenerdig gelegene Bistro im Gebäude Hodlerstrasse 6 vor. Es grenzt an den neu geschaffenen Museumsplatz und kann diesen mit Aussenbestuhlung beleben. Ein eigentliches Restaurant ist aber nicht vorgesehen, weil dies nicht zu den Kernaufgaben eines Museums gehört. Im Rahmen der Wettbewerbsvorbereitung wurden diesbezüglich diverse Abklärungen getroffen; dabei hat sich bestätigt, dass das Gastroangebot in der nahegelegenen Altstadt bereits sehr gut und umfassend ist.
Die Ausstellungsfläche nimmt von 3500 m2 auf rund 4’000m2 moderat zu (Zuwachs von 14%). Die Kunstvermittlung erhält für Workshops mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen rund 135m2 mehr. Im Vordergrund der Museumserneuerung steht damit nicht der maximierte Flächenzuwachs, sondern die Schaffung von Flächen, die für den Museumsbetrieb bestmöglich geeignet sind. Das Ziel sind wesentliche qualitative Verbesserungen der Ausstellungsräume, der Räume für die Kunstvermittlung, der Aufenthaltszonen für die Besucher:innen sowie der Infrastruktur für Kunstanlieferung und -logistik, Kulturgüterschutz, Sicherheit, Werkstätten und Gastronomie.
Die Kunstvermittlung erhält neue grosszügige Räume für ihre vielfältigen Angebote und direkten Zugang zur neu geschaffenen Aareterrasse. Die Kunstdepots erhalten angemessene Flächen und ein zeitgemässes Hänge- und Lagersystem. Ein moderner Veranstaltungsraum kann multifunktional genutzt werden. Die Gastronomie kann auch ausserhalb der Öffnungszeiten des Museums betrieben werden.
Wichtiger Bestandteil der geplanten Erneuerung des Kunstmuseums ist die Aufwertung des öffentlichen Raums. Dieser soll sowohl für Museumsbesucherinnen und -besucher wie auch für die Bevölkerung zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. Der neue Museumsplatz dient als Treffpunkt und Ort für Kunst im öffentlichen Raum. Der Stettlerbau (Altbau), der Ersatzneubau und das Gebäude Hodlerstrasse 6 bilden ein Ensemble. Zwischen Stettlerbau und Neubau führt eine breite Freitreppe hinunter zu der neugeschaffenen Aareterrasse, einem öffentlichen Aufenthaltsort, der sich unter anderem als Picknickplatz oder auch für die Kunstvermittlung nutzen lässt.
Nachhaltiges Museum
Die geplante Museumserneuerung setzt auf energieeffiziente und klimafreundliche Lösungen, sowohl bei der Sanierung, dem Umbau und Ersatzneubau wie auch im späteren Betrieb. Ein Kriterienkatalog mit allen relevanten Aspekten der Nachhaltigkeit ist in das Wettbewerbsprogramm eingeflossen. Dieses basiert auf der SIA-Norm «Nachhaltiges Bauen Hochbau» und der darauf aufbauenden detaillierten Struktur des Standards «Nachhaltiges Bauen Schweiz». Unter der Leitung von Brian Cody, Professor am Institut für Gebäude und Energie an der Technischen Universität Graz, war die Nachhaltigkeit während des ganzen Wettbewerbsverfahrens ein zentrales Eignungskriterium. Das Museum strebt Nachhaltigkeit in allen Dimensionen an; sie umfasst gleichermassen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte. Das Kunstmuseum verwendet bei der geplanten Erneuerung ressourcenschonende Materialien und geht sparsam mit diesen um; es optimiert seine Betriebs- und Liegenschaftskosten über den ganzen Lebenszyklus, leistet einen positiven regionalökonomischen Beitrag und fördert die kulturelle Teilhabe und Inklusion der unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen.
Studien zu Beginn des Wettbewerbsverfahrens haben ergeben, dass bezüglich Nachhaltigkeit über die ganze Lebensdauer der Gebäude keine Präferenzen zu Erhalt oder Neubau bestehen. Der Ersatzneubau verbraucht zwar bei der Erstellung mehr graue Energie, ermöglicht es aber in der Betriebsphase Energie, vor allem bei der Klimatisierung, einzusparen.
Damit sich die Zielvorgaben einhalten lassen, ist an verschiedenen Stellen anzusetzen: Gebäudeform, Energieversorgung, Baustoffe, Klima- und Lichttechnik. Mit der Realisierung des Siegerprojekts «Eiger» nach dem Grundkonzept «Zukunft Kunstmuseum Bern» – also mit Einbezug des Stettlerbaus und des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6 – lässt sich der Energieverbrauch gegenüber heute wesentlich optimieren: sowohl in Bezug auf den zu ersetzenden Atelier 5-Bau wie auf das Gebäudeensemble insgesamt. So sind beim Stettlerbau von 1879 die Dämmung und Isolation von Dach und der Ersatz von Fenstern vorgesehen, wodurch sich auch die haustechnischen Anlagen bezüglich Auslegung und Betrieb optimieren und der Energieaufwand und die Kosten für Klimatisierung und Heizung senken lassen. Das Gebäude an der Hodlerstrasse 6 aus den 1950er-Jahren wird ebenfalls so saniert und umgebaut, dass sie in Abstimmung mit den Vorgaben der Denkmalpflege heutige energetische Richtwerte anstrebt und im Betrieb ökologischer und günstiger wird. Die Realisierung des Ersatzneubaus und die gleichzeitige Sanierung des Stettlerbaus und des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6 ermöglichen Synergien im Bereich Energieversorgung und Gebäudetechnik; die architektonischen und bautechnischen Details werden im Rahmen der Projektierung zusammen mit Gebäudetechnik-Spezialisten erarbeitet.
Im Sinne eines optimierten Ressourceneinsatzes sollen die Transportwege der Baumaterialien von und zum Museum und die Herstellung von Produkten möglichst regional erfolgen. Bauteilsysteme und Materialien sollen robust und einfach im Unterhalt sein und zudem einen langen Werterhalt gewährleisten. Die Fassade des Ersatzneubaus wird, wie für den UNESCO-Perimeter vorgeschrieben, aus Berner Sandstein erstellt. Das Projekt sieht vor, die zwei untersten bestehenden Geschosse des heutigen Atelier 5-Baus auf der Aareseite in den Ersatzneubau zu integrieren, was ebenfalls graue Energie spart. Studien zu Beginn des Wettbewerbsverfahrens haben ergeben, dass bezüglich Nachhaltigkeit über die ganze Lebensdauer keine Präferenzen zu Erhalt oder Neubau bestehen. Die massive Bauweise verbraucht zwar bei der Erstellung mehr graue Energie, ermöglicht es aber in der Betriebsphase, Energie bei der Klimatisierung einzusparen.
Museen sind Gebäude mit hohen Anforderungen an konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Ausstellungsräumen sowie in den Räumen für den Kulturgüterschutz, was zu einem vergleichsweise hohen Energieverbrauch führt. Zu verfolgen sind architektonische Lösungen, die mit möglichst geringem technischem Aufwand den klimatischen Anforderungen gerecht werden. Eine CO2-freie Energieversorgung im Betrieb ist möglich, sofern der Strom und die Fernwärme aus erneuerbaren Energiequellen stammen.
Die massive Bauweise des Ersatzneubaus, die Verwendung von unterhaltsarmen Materialen, die Konstruktion sowie die neuen Klima- und Kälteanlagen ermöglichen einen ressourcenschonenden und energieeffizienten Betrieb. Das Gebäudevolumen des Ersatzneubaus ist kompakt: je kleiner das Volumen, desto weniger muss geheizt, befeuchtet und klimatisiert werden. Die substanziellen Mauern weisen eine gute thermische Speicherkapazität auf und tragen so zu einem stabilen Raumklima bei. Mit Blick auf das Raumklima ist auch der relativ geringe Fensteranteil ein Pluspunkt, wobei das Projekt diesbezüglich in der Projektierung noch optimiert wird. Um den Energieverbrauch für die Herstellung der notwendigen raumklimatischen Konditionen möglichst gering zu halten, ist in den Ausstellungsräumen eine Innenbeleuchtung geplant, die möglichst wenig Wärme abgibt.
Das künftige Kunstmuseum kommt mit einem Minimum an nicht erneuerbaren Energien aus und verursacht möglichst wenig Treibhausgasemissionen. Es bezieht erneuerbare Energie von lokalen Energieunternehmen. Bereits heute ist das Kunstmuseum an der städtischen Fernwärmeversorgung von Energie Wasser Bern angeschlossen. Diese effiziente Energieerschliessung soll weiterhin gesichert bleiben; der Treibhausgasemissionsfaktor der vorhandenen Fernwärme wird mit 46 kg CO2-eq pro MWh Fernwärme angegeben (2021). Für die Installation von Erdsonden fehlen auf dem Grundstück wegen der geplanten unterirdischen Bauten (Kulturgüterschutzraum) und der bestehenden Werkleitungen voraussichtlich die nötigen Flächen. Im Rahmen der Projektierung wird eine allfällige Nutzung des Aarewassers geprüft. Eventuell wäre auf dem Ersatzneubau auch eine Photovoltaikanlage möglich. Aufgrund der kleinen Fläche wäre ihr Beitrag an die Energieversorgung aber gering und die Bewilligung ungewiss, weil das Kunstmuseum im UNESCO-Schutzperimeter liegt. Dazu laufen derzeit weitere Abklärungen.
Insbesondere durch die Umgestaltung der Hodlerstrasse besteht die Möglichkeit, das Stadtklima zu verbessern. Dank versickerungsfähiger Oberflächengestaltung lässt sich der sommerlichen Überhitzung entgegenwirken. So kann Wasser in den Untergrund eindringen, das bei Hitze wieder verdunstet und die Umgebung kühlt. Die Pflanzung einer neuen Baumreihe leistet einen weiteren Beitrag zu einem angenehmen Stadtklima. Auch beim geplanten Museumsplatz ist eine Bepflanzung vorgesehen. Zudem entsteht zwischen dem Ersatzneubau und dem Stettlerbau eine Lücke, durch die kühlere Luft vom Aarehang in die Stadt fliesst.
Das Kunstmuseum Bern versteht sich als Teil der inklusiven Gesellschaft. Alle Menschen sind willkommen. Entsprechend will das Kunstmuseum Bern alle ansprechen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung sowie vom wirtschaftlichen und sozialen Status. Mit seinen analogen und digitalen Angeboten und Programmen fördert das Museum die kulturelle Teilhabe und baut aktiv Zugangshindernisse ab. Es hat die Generationen von morgen im Blick und verändert sich mit der sich permanent wandelnden Gesellschaft. Frei zugängliche Bereiche für alle tragen zur Öffnung ebenso bei wie Verweilmöglichkeiten in Innen- und Aussenräumen ohne Konsumzwang; so wird es möglich, die Luft des Kunstmuseums zu schnuppern und Architektur zu erleben, ohne dafür schon Eintritt zu bezahlen.
Wettbewerb und Siegerprojekt
In einem offenen 2-stufigen Architekturwettbewerb mit Präqualifikation haben 148 Architekt:innenteams ihre Bewerbung eingereicht. 39 wurden von der breit abgestützten Fach- und Sachjury ausgewählt und 11 davon später eingeladen, ihren Projektvorschlag weiter zu bearbeiten. Mit drei Teams folgte eine Bereinigungsstufe.
Der Wettbewerb war ab der 1. Stufe anonym. Das heisst, dass die Jury zwar wusste, welche 39 Architektenteams Beiträge einreichen, jedoch nicht, welcher Vorschlag von welchem Team eingereicht wurde. Die Vorschläge wurden auf ihre Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, Raumqualitäten, Nachhaltigkeit, Nutzbarkeit, Erstellungskosten, Materialwahl, etc. geprüft. Gewonnen hat 2024 das junge und innovative Büro Schmidlin Architekten (Zürich und Engadin), das u.a. für das Muzeum Susch (Graubünden) die Auszeichnung «Bau des Jahres 2019» von Swiss Architects gewann.
Das Siegerprojekt des internationalen Architekturwettbewerbs präsentiert für den anspruchsvollen Standort eine überzeugende Lösung und eignet sich am besten für die Weiterbearbeitung und Realisierung. Die Begründung der Jury lässt sich wie folgt zusammenfassen:
- Die Erneuerung des Kunstmuseums basiert auf einem markanten Ersatzneubau, der die Reihe der repräsentativen öffentlichen Bauten am nördlichen Aarehang ergänzt. Der Bau schöpft die in der Machbarkeitsstudie als möglich erachtete Höhe aus, bildet wie der Bühnenturm des Stadttheaters einen moderaten Hochpunkt und fügt sich gut in die Stadtsilhouette ein. Der freistehende Ersatzneubau bildet ein prägnantes Gegenüber zum neoklassizistischen Stettlerbau, der deutlich mehr Raum erhält und seine architektonische Eigenständigkeit zurückgewinnt.
- Dank dem zurückversetzten Ersatzneubau entsteht an der Hodlerstrasse ein grosszügiger Vorplatz, der zum Museumsbesuch einlädt und neue Nutzungen ermöglicht. Dadurch entstehen klare Mehrwerte sowohl für die Stadt wie für das Museum. Der neue Museumsplatz dient als Treffpunkt und Ort für Kunst im öffentlichen Raum. Das ebenerdig gelegene Bistro im Gebäude Hodlerstrasse 6 wird belebender Teil des Platzes.
- Der Stettlerbau, der Ersatzneubau und das Gebäude Hodlerstrasse 6 bilden um den Museumsplatz ein Ensemble, architektonisch zusammengehalten durch die kluge räumliche Anordnung der Gebäude. Die drei klar voneinander abgegrenzten Gebäude aus unterschiedlichen Epochen treten mit ihren Eigenheiten miteinander in einen Dialog und verleihen dem Museumsplatz eine dynamische Wirkung.
- Ein terrassenförmig angelegter Hofgarten verbindet den Ersatzneubau und das Bistro und verhilft der Stadtmauer zu neuer Beachtung. Zwischen Stettlerbau und Ersatzneubau führt eine breite Freitreppe hinunter zu der neugeschaffenen Aareterrasse, einem öffentlichen Aufenthaltsort, der sich vielseitig nutzen lässt - als Picknickplatz für Schulen oder für Aktivitäten der Kunstvermittlung.
- Die städtebauliche Klarheit wird im Innern fortgesetzt. Der Haupteingang zum Kunstmuseum im Ersatzneubau öffnet ein von aussen einsehbares, grosszügiges Foyer, das unabhängig vom Museumsbesuch zugänglich ist und wo verschiedene Aktivitäten stattfinden können. Von hier aus führen die Treppen und Aufzüge übersichtlich durch das gesamte Gebäude. Der Museumsbesuch wird zum «zweigeteilten» und damit doppelten Erlebnis: Zum einen lässt sich der Ersatzneubau erkunden, der aus drei autonomen, übereinander liegenden Ausstellungsräumen besteht. Zum anderen bietet das neue Gebäude einen Übergang zum Stettlerbau und ermöglicht so das Eintauchen in das Wesen des Kunstmuseums aus dem 19. Jahrhundert. Ein weitläufiger Ausstellungsraum unter dem Museumsplatz verbindet den Ersatzneubau mit dem Stettlerbau und führt in einen doppelt hohen Raum mit unerwartetem Licht und Ausblicken.
- Der Ersatzneubau hat eine einzigartige Fassade, die Elemente der Berner Steinbruchtradition aufnimmt. Die Sandsteinfassade weist im Erdgeschoss eine raue Oberfläche auf und ist nach oben zunehmend geglättet. Gezielt gesetzte Fensteröffnungen ermöglichen einzigartige Ein- und Ausblicke. Im dritten Obergeschoss schafft eine Oberlichtdecke eine besondere Atmosphäre.
Bern erhält einen markanten Museumsbau mit zeitloser Ausstrahlung und einem identitätsstiftenden Museumsplatz; es entsteht ein offenes, gut auffindbares Museum, das nicht hinter geschlossenen Mauern und Fassadenfragmenten verborgen ist. Das Kunstmuseum wird zum lebendigen, mit dem öffentlichen Raum verbundenen Ort.
Der Projektname «Eiger» passt bestens: Der prägnante, freistehende Ersatzneubau strahlt Beständigkeit aus, seine schnörkellose Erscheinung steht für dauerhafte Werte und nimmt gleichsam die Erhabenheit des Alpenpanoramas auf. Dass an den Rändern der Altstadt höhere und repräsentative Bauten stehen, ist ein Merkmal der Stadt Bern. Der Ersatzneubau fügt sich gut in die Stadtsilhouette ein und lässt das Kunstmuseum auch aus der Ferne wirken; bei der Einfahrt in Bern mit dem Zug oder von der Kornhausbrücke aus ist das Kunstmuseum gut erkennbar. Das Siegerteam Schmidlin Architekten hat die Chance genutzt, einen zeitgenössischen Museumsbau zu konzipieren, der gut in die UNESCO-Stadt Bern eingebettet ist.
Das junge und innovative Büro Schmidlin Architekten (Zürich und Engadin) hat Erfahrung mit komplexen öffentlichen Bauaufgaben und befasst sich intensiv mit Umbauten und Erneuerungen denkmalgeschützter Objekte im städtischen und ländlichen Kontext. Das Team hat in Susch im Unterengadin mehrere historische Gebäude, deren Ursprünge teils bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen, in ein Museum für zeitgenössische Kunst umgebaut. Es gelang dem Team, den geschützten historischen Bestand zu bewahren und gleichzeitig neue Ausstellungsräume zu schaffen, die heutigen Anforderungen entsprechen. 2019 wurde das Muzeum Susch bei Swissarchitects zum Bau des Jahres gewählt. Gegenwärtig arbeitet das Büro u.a. am Umbau und der Sanierung des Historischen Museums Thurgau im denkmalgeschützten Schloss Frauenfeld. In Würenlingen im Kanton Aargau hat das Team ein spätbarockes denkmalgeschütztes Bauernhaus im historischen Dorfkern in ein Kulturzentrum umgebaut und durch einen Anbau erweitert; darin sind die öffentliche Bibliothek, Ausstellungsräume und ein Saal eingerichtet. In Basel haben Schmidlin Architekten in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Autowerkstatt eine Kunstgalerie realisiert. Für die Restaurierung eines 500-jährigen Stalls (Projekt Stalla Madulain) gewann das Büro 2014 den Preis für nachhaltiges Sanieren und Bauen im Alpinen Raum.
Bei der Weiterentwicklung des Projekts soll das Potenzial der Fassade für eine weitergehende Gliederung genutzt werden, um vertiefte Bezüge zur Umgebung herzustellen. Ferner ist zu überprüfen, wie umfangreich in den geschützten Gebäuden Stettlerbau und Hodlerstrasse 6 Eingriffe möglich sind. Bei der Gestaltung des Aussenraums ist zur Verbesserung des Stadtklimas eine Bepflanzung vorgesehen. Mit Blick auf die Mehrfachnutzung des Foyers und des Multifunktionsraums werden die verschiedenen Bedürfnisse mit dem kuratorischen Konzept des Museums abgestimmt. Ein Ausschuss der Jury wird die Überarbeitung des Projekts begleiten. Die Weiterentwicklung findet in Zusammenarbeit mit der städtischen Denkmalpflege statt. Der Denkmalpfleger war Mitglied der Fachjury.
Die Räume im Ersatzneubau ermöglichen dank ihrer Grösse, Flexibilität, Höhe, den Lichtverhältnissen und höheren zulässigen Traglasten Ausstellungen, die bisher im Kunstmuseum Bern nicht realisierbar waren. Die neuen Räume und klaren Besucherwege bilden eine wertvolle Ergänzung zu den historischen Ausstellungsräumen im Stettlerbau, wo sich die Sammlung des Kunstmuseums und Ausstellungen in sanierten Räumen neu erleben lassen.
Das Projekt bringt eine umfassende Optimierung und Vereinfachung der Kunst- und Warenlogistik. Lastenaufzüge erschliessen alle Geschosse, die Lage der Räume (Anlieferung, Annahme- und Ausgabe, Arthandling, Kulturgüterschutz) ermöglicht einen ressourcenschonenden Betrieb. Dank klarer Grundrisse lässt sich auch die Sicherheit optimieren. Hinzu kommen neue effiziente Systeme für Klimaanlage und Heizung, eine neue Dämmung, die Isolierung des Dachs, neue Fenster sowie die Verwendung von unterhaltsarmen Materialen und Konstruktionen. Das alles ermöglicht einen deutlich effizienteren Betrieb bzw. stabile Betriebskosten bei gleichzeitig grösserer Fläche. Trotz mehr Ausstellungsfläche ist nicht mehr Personal für Kasse, Shop und Aufsicht erforderlich. Dies wurde bereits genau geprüft. Der Energiebedarf wird durch die Massivbauweise des Ersatzneubaus und die erneuerte Klima- und Kältetechnik reduziert sowie die Kunstlogistik durch die Anordnung der Räume verbessert.
Zusammenfassend kann festgestellt werden:
- Das Projekt kann mit dem derzeitigen Personalstand für Aufsicht, Reinigung, Kasse, Shop und Gebäudemanagement betrieben werden.
- Der Energieverbrauch sinkt aufgrund der wesentlich besseren Bausubstanz und der wesentlich höheren Energieeffizienz der neuen Klima- und Kälteanlagen.
- Die Betriebskosten bleiben insgesamt stabil.
Die derzeitige Gebäudesituation mit unterschiedlichsten Niveaus, schwieriger Anlieferung, zu kleinen Depotanlagen, provisorischen Werkstätten, ineffizienter und veralteter Technik sowie schlechter Dämmung ist unzureichend und nicht mehr zeitgemäss. Die Lösungskonzepte mit Ersatzneubau einer 2019 erstellten Machbarkeitsstudie erlauben einen deutlich effizienteren und ressourcenschonenderen Betrieb bei stabilen Bewirtschaftungskosten. Gleichzeitig nimmt die Ausstellungsfläche in hoher Qualität und attraktivem Umfang zu. Das auf diese Weise nachhaltig erneuerte Kunstmuseum lädt – eingebettet zwischen dem Stadtleben und Aarehang – zur Begegnung und zum Austausch ein und bietet Raum für aussergewöhnliche Kunsterlebnisse, Reflexion und Forschung. Zusammen mit der von der Stadt Bern geplanten Aufwertung des Gebietes zwischen Bundeshaus und Hodlerstrasse bietet sich die Chance, den Stadtraum mit dem neuen Kunstmuseum in Verbindung zu setzen und damit die gesamte Obere Altstadt aufzuwerten.
Kosten und Finanzen
Die Gesamtkosten für die Sanierung des Stettlerbaus, des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6 und für den Ersatzneubau belaufen sich per 2023 auf rund 133.5 Mio. Franken (bzw. 147 Mio. Franken mit einer angenommenen Teuerung von 10% bis 2033).
Reserven sind im Umfang von ca. 10 Mio. eingerechnet. Die Kostengenauigkeit von +/- 25% entspricht dem aktuellen Projektierungsstand und wird mit der weiteren Konkretisierung des Projekts am Ende wie üblich +/- 10% betragen.
Das Kostenmanagement nach Design-to-cost-Methode stellt die Einhaltung der Kostenvorgaben sicher. Um negative Überraschungen so weit wie möglich auszuschliessen, wurden potenzielle Risiken – insbesondere Baugrund, Baugrube und Unterfangungen – sorgfältig beurteilt und in der Grobkostenschätzung abgebildet.
Kostenaufstellung (Kostengenauigkeit +/- 25%):
Sanierung Stettlerbau (Altbau) 27.2 Mio.
Sanierung Gebäude Hodlerstrasse 6 17.7 Mio.
Ersatzneubau (inkl. Anpassung Ausfahrt Metroparking) 88.6 Mio.
Total (Preisstand April 2023) 133.5 Mio.
Teuerung (Annahme 10% bis 2033) 13.35 Mio.
Gesamtkosten per 2033 (inkl. angenommene Teuerung; gerundet) 147 Mio.
Eine umfassendere Sanierung, die auch das Gebäude an der Hodlerstrasse 6 einbezieht, wäre für den Kanton teurer als das Projekt Eiger, das neben einer umfassenden Sanierung des Stettlerbaus die Erstellung eines Ersatzneubaus beinhaltet. Dies, weil die privaten Mittel im Umfang von 52 Mio. Franken wegfallen würden und auch die Beiträge aus dem Lotteriefonds geringer wären.
Die reine Sanierung der beiden bestehenden Museumsgebäude wäre für den Kanton etwas kostengünstiger, erfüllt die in der Machbarkeitsstudie gestellten Anforderungen an einen zeitgemässen Museumsbetrieb aber in keiner Weise und hätte für das Kunstmuseum Bern weitreichende Nachteile. Da auf die Nutzung des Gebäudes Hodlerstrasse 6 verzichtet würde, bliebe die Administration im Atelier 5-Bau; als Folge liesse sich die Kunstanlieferung nicht im erforderlichen Mass verbessern. Das Einsparpotential für den Kanton würde per 2023 rund 1 Mio. Franken betragen (bzw. 7 Mio. Franken inkl. Teuerung bis 2033).
Der Variantenvergleich zeigt, dass sich dank dem Einsatz der privaten Mittel für den Kanton eine deutlich attraktivere und nachhaltigere Gesamtlösung realisieren lässt. Für Mehrkosten von ca. 1 Mio. Franken (bzw. 7 Mio. Franken inkl. Teuerung) kann der Kanton eine zeitgemässe, nachhaltige Infrastruktur für das Kunstmuseum sicherstellen und schafft damit einen erheblichen Mehrwert für kommende Jahrzehnte.
Sanierung
Sanierung+
Eiger
Kurzbeschrieb - Stettlerbau und Atelier 5-Bau werden saniert.
- Keine Umnutzungen, keine Erweiterungen, keine Nutzungsumlagerungen.
- Stettlerbau und Atelier 5-Bau werden saniert
- Administration zieht in Gebäude Hodlerstrasse 6 um, das ebenfalls saniert wird.
- Stettlerbau wird saniert.
- Gebäude Hodlerstrasse 6 wird saniert und für Gastronomie und Administration verwendet.
- Atelier 5-Bau wird durch Neubau ersetzt.
Total Investitionskosten
(Preisstand April 2023)
70.9 Mio.
92 Mio.
133.5 Mio.
Finanzierungsmodell
Private Mittel 0 0 -52 Mio. Beiträge aus dem Lotteriefonds (Schätzung BKD) -4 Mio. -5 Mio. -14 Mio. beim Kanton Bern zu beantragende ordentliche Staatsmittel
(Preisstand April 2023; gerundet)
67 Mio. 87 Mio. 68 Mio. Total beim Kanton Bern zu beantragende ordentliche Staatsmittel inkl. 10% Teuerung bis 2033 74 Mio. 96 Mio. 81 Mio. Für Details siehe Kapitel 3.6 im Vortrag «Zukunft Kunstmuseum Bern» - Sanierung und Ersatzneubau. Kantonsbeitrag an die Projektierung, Verpflichtungskredit 2026-2028.
Geplanter Beitrag Kunstmuseum Bern (Spenden/Sponsoring/Fundraising) 52 Mio.
Geplanter Beitrag Lotteriefonds (Schätzung BKD) 14 Mio.
Geplanter Beitrag Kanton Bern 81 Mio.
Total 147 Mio.
Die Finanzierung soll durch die öffentliche Hand, den Lotteriefonds, private Mäzene und Stiftungen sowie durch die Wirtschaft erfolgen. Der Finanzierungsplan sieht vor, dass der Kanton die Kosten für die Sanierung des Stettlerbaus (Altbau) sowie die Kosten, die für die Sanierung des Atelier 5-Baus angefallen wären, übernimmt. Zusätzlich wird dem Kanton beantragt, die Kosten der Teuerung zu übernehmen, da die Stiftung Kunstmuseum Bern dieses Risiko nicht tragen kann. Dies ergibt für den Kanton 68 Mio. Franken per 2023 (bzw. 81 Mio. Franken bei einer angenommenen Teuerung von 10% in den Jahren 2023-2033).
Sowohl für die Sanierung der bestehenden Gebäude als auch für den Ersatzneubau soll zudem beim Lotteriefonds insgesamt ca. 14 Mio. Franken beantragt werden.
Hansjörg Wyss, Vorsitzender der Wyss Foundation Europe, trägt mit seinem grosszügigen Engagement insgesamt 30 Mio. Franken bei: 20 Mio. für den Ersatzneubau und 5 Mio. für die Aufwertung der Aufenthaltsqualität an der Hodlerstrasse, namentlich mit der Aufhebung der Ausfahrt Metroparking. Weitere 5 Mio. leistet er unter der Bedingung, dass für die Erneuerung des Museums weitere Privatmittel in der Höhe von mindestens 7,5 Mio. zusammenkommen.
Der Finanzierungsplan rechnet insgesamt mit Beiträgen von Privaten, Stiftungen und der Wirtschaft in der Höhe von 52 Mio. Franken (inklusive des Beitrags von Hansjörg Wyss). Per Dezember 2025 sind 38,5 Mio. Franken zugesichert (74%).
Die Kosten, die dem Kanton Bern laut Finanzierungsplan für den Ersatzneubau sowie für die Sanierung des Stettlerbaus und des Gebäudes Hodlerstrasse 6 zur Übernahme beantragt werden sollen, belaufen sich per 2023 auf 68 Mio. Franken (bzw. 81 Mio. Franken bei einer angenommenen Teuerung von 10% in den Jahren 2023-2033).
Die Sanierung des Stettlerbaus (Altbau) ist unabhängig vom Projekt «Zukunft Kunstmuseum Bern» nötig.
Investitionskosten Projekt Eiger
Vorbereitungsarbeiten 13’950’700
Gebäude (inkl. Reserve) 64’274’100
Betriebseinrichtungen 1’040’000
Umgebung 6’551’896
Baunebenkosten 5’296’300
Honorare 23’309’800
Ausstattung / Auslagerung Kunst 9’045’346
Zwischentotal 123’468’142
Mehrwertsteuer 8.1% 10’000’920
Rundung 30’938
Total (Preisstand April 2023) 133’500’000
Finanzierungsmodell
Private Mittel -52’000’000
Beiträge aus dem Lotteriefonds
(Schätzung BKD)
-14'000’000
beim Kanton Bern zu beantragende
ordentliche Staatsmittel
Preisstand April 2023 (gerundet)
68’000’000
Total beim Kanton zu beantragende
ordentliche Staatsmittel
inkl. 10% Teuerung bis 2033
81’000’000
Bei der Realisierung des Siegerprojektes können die Sanierungen des Stettlerbaus und des Gebäudes Hodlerstrasse 6 sowie die Erstellung des Ersatzneubaus nicht etappiert werden, da die Gebäude- und deren Nutzungen integral miteinander verbunden sind. Zudem wird ein unterirdischer Ausstellungsraum erstellt, der den Ersatzneubau mit dem Stettlerbau verbindet. Dafür sind wesentliche bauliche und technischen Massnahmen erforderlich, die beide Gebäude betreffen und aufeinander abgestimmt werden müssen.
Die gleichzeitige Sanierung des Stettlerbaus und die Realisierung des Ersatzneubaus ermöglichen zudem planerische, bauliche, betriebliche und finanzielle Synergien und reduzieren die Belastung für die Anrainer: So muss nur einmal eine Baustelle eingerichtet werden, gewisse Elemente im Bereich Sicherheit, Brandschutz, Gebäudeautomation können gesamtheitlich erneuert werden und aufgrund des grösseren Projektumfangs ergeben sich grössere Auftragsvolumen und somit bessere Einheitspreise. Zudem muss das Kunstmuseum nur einmal geschlossen werden; nach Abschluss der Bauarbeiten ist das Museum wieder voll funktionsfähig und zugänglich.
Die Gesamtkosten für die Sanierung des Stettlerbaus (Altbau), des Gebäudes an der Hodlerstrasse 6 und für den Ersatzneubau belaufen sich per 2023 auf rund 133.5 Mio. Franken.
Um eine höchstmögliche Genauigkeit und Transparenz der Kosten auszuweisen, hat das Kunstmuseum Bern versucht die Preissteigerungen durch die Teuerung zu berücksichtigen. Da keine langfristigen Teuerungsprognosen existieren, wurde für die Zeitspanne 2023-2033 jährlich 1% Teuerung angenommen. Dieses angenommene eine Prozent ist im mittleren Bereich der bei Preisstabilität angestrebten Teuerung (0%-2%) angesetzt. Trifft die Prognose von jährlich 1% Teuerung zu, werden die Gesamtkosten für die Erneuerung des Kunstmuseums nach Abschluss der Bauarbeiten rund 147 Mio. Franken betragen (anstelle der heutigen 133.5 Mio.).
Auf 40 Mio. Franken wurde im Jahr 2019 der 50%-Anteil des Kantons Bern für einen Ersatzneubau geschätzt. In dieser Summe ist weder die aufgelaufene Bauteuerung in den Jahren 2019-2023 (14 Prozent) berücksichtigt, noch sind die Kosten für die Sanierung des Altbaus enthalten. Teuerungsbereinigt liegt der Ersatzneubau immer noch innerhalb der Zielkosten.
Das Kunstmuseum Bern wird gemäss dem kantonalen Kulturförderungsgesetz als Kulturinstitution von nationaler Bedeutung mittels Leistungsvertrag direkt durch den Kanton Bern finanziert. Mit der kantonalen Kulturförderungsverordnung von 2013 übernahm der Kanton Bern auf Ebene der öffentlichen Hand die alleinige Finanzierungsverantwortung. Die Gemeinden sind somit nicht in der Pflicht, sich an der Finanzierung des Sanierungs- und Bauprojektes zu beteiligen. Im Rahmen des Fundraisings der Stiftung Kunstmuseum Bern werden neben Anfragen an Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen auch Anfragen an die Agglomerationsgemeinden geprüft.
Gleichwohl blieben die beiden anderen öffentlich-rechtlichen Stifterinnen (Stadt Bern und Burgergemeinde Bern) mit dem Kunstmuseum Bern eng verbunden, da sie beide gemeinsam mit dem Kanton Bern am 10. September 1875 die Stiftung Kunstmuseum Bern gegründet haben.
Um die geplante Erneuerung zu ermöglichen, hat die Stadt Bern entschieden, den Gebäudeteil Hodlerstrasse 6 kostenlos im Baurecht der Stiftung Kunstmuseum Bern abzugeben. Weiter plant die Stadt, die Hodlerstrasse abgestimmt auf den geplanten Museumsneubau aufzuwerten, dazu die Ausfahrt des Metro-Parking zu verschieben und die Neugestaltung des Bären- und Waisenhausplatzes koordiniert voranzutreiben. Damit übernimmt die Stadt Bern Kosten in Millionenhöhe.
Die Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern hat bereits vor Publikation des Wettbewerbsergebnisses ein Zeichen für das Kunstmuseum Bern gesetzt und einen Beitrag von 2 Mio. Franken gesprochen. Mittlerweile hat die Museumsstiftung ihren Beitrag auf 5 Mio. Franken erhöht.
In den vergangenen Jahren sind die Baukosten infolge der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und weiterer Faktoren erheblich gestiegen. Um eine möglichst hohe Kostentransparenz und -genauigkeit zu gewährleisten, hat das Kunstmuseum Bern diese Preissteigerungen versucht zu berücksichtigen.
Für die Zeitspanne 2023-2033 wurde jährlich 1% Teuerung angenommen, da keine langfristigen Teuerungsprognosen existieren. Dieses angenommene eine Prozent ist im mittleren Bereich der bei Preisstabilität angestrebten Teuerung (0%-2%) angesetzt. Zum Zeitpunkt der Beantragung des Realisierungskredits kann die zu erwartende Teuerung basierend auf Prognosemodellen der Schweizerischen Nationalbank aktualisiert werden. Das genaue Ausmass der zukünftigen Teuerung wird somit nach erfolgter Projektierung und beim für 2028 geplanten Antrag für den Realisierungskredit besser beurteilt werden können.
Trifft die Prognose von insgesamt 10% bis 2033 zu, werden die Gesamtkosten für die Erneuerung des Kunstmuseums nach Abschluss der Bauarbeiten rund 147 Mio. Franken betragen (anstelle der heutigen 133.5 Mio.).
Ja, im September 2025 hat der Grosse Rat mit grosser Mehrheit (91 Ja / 44 Nein / 16 Enthaltungen) den Projektierungskredit über 15.7 Mio. Franken und ein Kostendach von 81 Mio. Franken für das Gesamtprojekt beschlossen. Ein Komitee hat gegen diesen Entscheid das Referendum ergriffen. Damit steht eine kantonale Abstimmung über den Projektierungskredit «Zukunft Kunstmuseum Bern» im Jahr 2026 an.
Sämtliche Unterlagen des Grossen Rates sind hier öffentlich zugänglich:
Der Atelier 5-Bau darf aus mehreren Gründen nur bis Ende 2030 betrieben werden. Nur dank verschiedenen Sofortmassnahmen (u.a. Verstärkung mit Stahlwinkeln und Stahlkreuzen) liess sich 2019 der Betrieb bis Ende des Jahrzehnts sichern. Wird der Planungs- oder Realisierungskredit von der Bevölkerung abgelehnt, muss ein neues Projekt ausgeschrieben und projektiert werden. Dafür gibt es drei Varianten:
- Verzicht auf Sanierung: Auf die Sanierung des Atelier 5-Baus wird verzichtet, das Gebäude wird geschlossen. Dadurch stehen 2000 m2 weniger Ausstellungsfläche zur Verfügung. Das Kunstmuseum ist nicht mehr in der Lage, das Ausstellungsprogramm und die Sammlungspräsentation gemäss Leistungsvertrag aufrechtzuerhalten. Die internationale Leihe von Kunstwerken kommt wegen der schlechten Anlieferungssituation zum Erliegen. Wahrscheinliche Folgen des eingeschränkten Angebots: Sponsoringeinnahmen und Drittmittel brechen ein, neue Legate bleiben aus. Das Museum erfüllt vertraglich geregelte Ansprüche (Stiftungsurkunden, assoziierten Stiftungen) nicht mehr und muss die Kunstvermittlungsangebote für Schulen einschränken. Die für das Projekt «Zukunft Kunstmuseum Bern» zugesicherten Privatmittel fallen weg. Der Kanton Bern büsst an Renommee ein.
- Variante Sanierung: Die bestehenden Gebäude werden saniert und wie bisher weiterbetrieben. Die Ausstellungsfläche nimmt gegenüber heute nicht ab, aber das Versprechen, ein offenes, mit der Stadt verbundenes und barrierefreies Museum zu werden, lässt sich nicht einlösen. Die Anlieferungssituation bleibt unverändert, das Museum wird vom internationalen Leihverkehr abgehängt, das bisherige Ausstellungsprogramm lässt sich nicht fortführen. Die Betriebskosten bleiben hoch. Das Raumangebot für Bildung und Vermittlung entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Die Hodlerstrasse wird nicht aufgewertet und belebt, und die Stadt nicht mit dem Aarehang verbunden. Die Chance, für dieses Projekt private Gelder aufzutreiben, ist begrenzt; die von Hansjörg Wyss zugesicherten 30 Mio. Franken fallen weg. Da für eine Sanierung nur geringe private Mittel generiert werden können, kostet die Sanierungsvariante ohne zusätzlichen Nutzen für den Kanton per 2023 rund 67 Mio. Franken und damit rund 1 Mio. Franken weniger als das Siegerprojekt.
- Variante Sanierung+: Diese Variante umfasst die Sanierung des Atelier 5-Baus, die Sanierung des Stettlerbaus, die Erstellung eines neuen Kunstdepots, die Auslagerung der Administration in das Gebäude Hodlerstrasse 6 und die Verbesserung der Kunstanlieferung. Gegenüber der Variante Sanierung lassen sich wesentliche Verbesserungen der betrieblichen Abläufe erzielen. Die Verschiebung der Administration in das Gebäude Hodlerstrasse 6 ermöglicht es, die unteren Geschosse im Atelier 5-Bau neu zu konzipieren und für die Anlieferung eine funktionsfähige Lösung zu finden. Zudem kann die Ausstellungsfläche um ca. 500m2 vergrössert werden, dies jedoch bei eingeschränkter Raumqualität (Raumakustik, Licht, Traglasten, Höhe etc.). Die Kulturgüterschutzräume (Kunstdepot), Ateliers und Werkstätten lassen sich optimieren und besser auf die Anforderungen abstimmen. Die Barrierefreiheit kann nicht wesentlich verbessert werden. Die zu Beginn der Machbarkeitsstudie formulierten Anforderungen an einen zeitgemässen Museumsbetrieb (Funktionalität und hohe Aufenthaltsqualität der Ausstellungsräume, attraktive Räume für Kunstvermittlung, einladender offener Eingangsbereich etc.) werden nur teilweise erfüllt. Da für eine Sanierung nur geringe private Mittel generiert werden können, kostet die Variante Sanierung+ den Kanton per 2023 rund 87 Mio. Franken und ist damit wesentlich teurer als das beantragte Siegerprojekt «Eiger».
Der Finanzierungsplan rechnet insgesamt mit Beiträgen von Privaten, Stiftungen und der Wirtschaft in der Höhe von 52 Mio. Franken. Per Dezember 2025 liegen private Zusagen im Umfang von 38,5 Mio. Franken vor (= 74%):
- CHF 30 Mio. Wyss Foundation Europe
- CHF 5 Mio. Museumsstiftung für Kunst der Burgergemeinde Bern
- CHF 3,5 Mio. Privatpersonen und Stiftungen
Gegenwärtig werden Gespräche und Verhandlungen mit einer Vielzahl von Mäzenen und Mäzeninnen, Stiftungen und Unternehmen geführt, um den offenen Finanzierungsbedarf von 13,5 Mio. Franken abzusichern.
Ja. Der Vertrag zwischen der Wyss Foundation und der Stiftung Kunstmuseum Bern wurde 2022 rechtsgültig unterzeichnet und im April 2025 auf die Wyss Foundation Europe übertragen. Der Vertrag mit der Wyss Foundation Europe basiert auf dem Grundkonzept «Zukunft Kunstmuseum Bern». Die wesentlichen Elemente des Konzepts sind die Ausweitung der Denkzone auf das Gebäudeensemble mit Stettlerbau, Atelier 5-Bau und Hodlerstrasse 6 (im Baurecht durch Stifterin Stadt Bern) sowie die Aufwertung der Hodlerstrasse durch ein neues Verkehrsregime und die neuorganisierte Ein- und Ausfahrt des Metro-Parking. Das Gesamtkonzept wurde partnerschaftlich entwickelt, wobei die jeweiligen Bauträger die Kosten übernehmen. Die Stiftung Kunstmuseum Bern soll mit einem kantonalen Beitrag und der Unterstützung von Hansjörg Wyss sowie weiterer privater Geldgeber:innen und Stiftungen die Museumsbauten finanzieren. Die Stadt übernimmt die Kosten für die öffentlichen Plätze und Strassen.
Das Gebäude Hodlerstrasse 6 spielt beim Erneuerungsprojekt eine Schlüsselrolle: Das Kunstmuseum erhält in direkter Nachbarschaft ein Gebäude für die Administration, Lager/Depots sowie das Bistro und muss so im Ersatzneubau keine neuen teuren Büroflächen bauen. Dies ermöglicht mehr Fläche für die Kunst und ist ein Beitrag zu einer nachhaltigen Immobiliennutzung. Die Lösung bringt auch organisatorische Vorteile: Bei vielen Abteilungen des Kunstmuseums bestehen starke betriebliche Abhängigkeiten, z. B. bei Kunstvermittlung, Archiv, Sammlungsbetreuung und Ausstellungsmanagement. Die Administration anderswo in der Stadt oder Region unterzubringen, wäre auch finanziell ungünstig: Zusätzliche Mieten würden die Betriebskosten künftig dauerhaft erhöhen. Das Bistro kann vom Ausstellungsbetrieb getrennt wirtschaftlich betrieben werden.
Die Sanierung der Hodlerstrasse 6 ist in der aktuellen Kostenschätzung enthalten.
Gemeinde- und Stadtrat tragen auf verschiedene Weise zum Erfolg des Projekts «Zukunft Kunstmuseum Bern» bei. Um die geplante Erneuerung zu ermöglichen, haben sie entschieden, den Gebäudeteil Hodlerstrasse 6 kostenlos im Baurecht der Stiftung Kunstmuseum Bern bis 31. Dezember 2108 abzugeben. Dies wird möglich, weil die heutige Mieterin, die Kantonspolizei Bern, in Niederwangen ein neues Polizeizentrum errichtet (Bezug 2028). Weiter plant die Stadt, die Hodlerstrasse abgestimmt auf den geplanten Museumsneubau aufzuwerten, dazu die Ausfahrt des Metro-Parking zu verschieben und die Neugestaltung des Bären- und Waisenhausplatzes koordiniert voranzutreiben. Die Kosten für die Aufwertung der Hodlerstrasse sind noch nicht bekannt, werden aber mehrere Millionen Franken betragen, welche die Stadt Bern tragen wird. Wer die Kosten der Verlegung der Ausfahrt des Metro-Parking zu welchen Teilen übernehmen wird, ist Gegenstand von laufenden Verhandlungen zwischen dem Kunstmuseum und der Stadt. Für die Verlegung der Ausfahrt Metro Parking hat die Wyss Foundation Europe dem Kunstmuseum Bern vertraglich 5 Mio. Franken zugesichert.
Es ist nicht möglich, die Museumserneuerung durch den Verkauf von Kunstwerken aus der Sammlung mitzufinanzieren. Das Kunstmuseum Bern ist Mitglied des internationalen Museumsverbandes ICOM (International Council of Museums). Nur Institutionen, die von ICOM anerkannt sind, gelten als Museen nach internationalen Standards. Die Mitgliedschaft bei ICOM ist für den Kanton Bern Voraussetzung für den Leistungsvertrag mit dem Kunstmuseum Bern. Gemäss den ethischen Richtlinien des Verbands sind Museen der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet, das ihnen anvertraute Kulturgut dauerhaft zu bewahren und zu schützen. Der Erlös aus einem Verkauf eines Sammlungsobjektes ist ausschliesslich «zum Nutzen der Sammlung – im Regelfall für Neuerwerbungen eben dieser – zu verwenden.» (ICOM, ethische Richtlinien 2.16).
Vielfacher Nutzen
Die Erfahrungen bei anderen Museumsbauprojekten in der Schweiz zeigen, dass mit einem Neubau in den ersten Jahren das Interesse der Besucher:innen erheblich steigt. Später wird wieder das Ausstellungsprogramm entscheidend für den Zuspruch sein. Mit dem Ersatzneubau sind attraktivere Angebote und Kunsterlebnisse möglich, womit sich die Chance bietet, die Zahl der Besucher:innen nachhaltig zu erhöhen. Angestrebt wird eine Erhöhung des langjährigen Besucher:innen-Durchschnitts um 25 %. Das Kulturpublikum legt laut Studien in der Regel nicht nur grossen Wert auf das kulturelle, sondern ebenso auf das gastronomische Angebot. Eine 2024 vom Kunstmuseum Bern in Auftrag gegebene Studie der Forschungsstelle Tourismus der Universität Bern zeigt auf, dass die gesamte jährliche Bruttowertschöpfung des Kunstmuseums im Kanton Bern sich auf rund 10.5 Mio. Franken beläuft. Das sind bei 100’000 Besuchenden im Jahr ca. 100 Franken pro Eintritt.
Das künftige Kunstmuseum Bern bietet ein einzigartiges, ganzheitliches Kunst- und Kulturerlebnis mit nationaler und internationaler Ausstrahlung. Das Kunstmuseum Bern spricht alle Menschen an und inspiriert zur Auseinandersetzung mit Kunst und gesellschaftlichen Werten, zu Begegnung, Dialog und Interaktion.
Alle seine Aktivitäten richten sich an Jung und Alt, an versierte Kunstinteressierte, eine in ihrer ganzen Vielfalt inklusiv verstandene Bevölkerung, Einwohnerinnen und Besucher gleichermassen. Das Kunstmuseum Bern ist lebendiger Ort für aussergewöhnliche Kunsterlebnisse, Reflexion, Forschung und Begegnung. Mit der neuen Infrastruktur kann das Kunstmuseum Bern so auch in Zukunft seinen Auftrag erfüllen, also den Schutz, die Pflege und die Vermittlung der ihm anvertrauten hochkarätigen Kunstsammlung sicherstellen, Angebote für Schulklassen aus dem ganzen Kanton unterbreiten, anderen Kulturhäusern im Kanton Bilder ausleihen und bei Fragen der Provenienzforschung Hilfe leisten. Die nationale und internationale Ausstrahlung des Kunstmuseums Bern bleibt gewahrt, der Betrieb für die Bevölkerung und nachfolgende Generationen ist gesichert. Die Museumserneuerung setzt auf energieeffiziente Lösungen für Sanierung, Umbau und Ersatzneubau und lebt somit die Nachhaltigkeitsstrategie des Kantons Bern nach.
Die Stadt profitiert als Bundesstadt und Kantonshauptort in mehrfacher Hinsicht vom erneuerten Museum: Nebst dem kulturpolitischen Nutzen und den neuen Chancen für Hotellerie, Gastronomie und Detailhandel bietet sich die einmalige Möglichkeit, die Neugestaltung der Hodlerstrasse auf den Museumsneubau abzustimmen und auf diese Weise die Stadt städtebaulich aufzuwerten. Zusätzlichen Nutzen bringt die ebenfalls mit der Museumserneuerung koordinierte, aber unabhängig davon geplante Aufwertung des Bären- und Waisenhausplatzes: So lässt sich der Stadtraum mit dem attraktiveren Kunstmuseum in Verbindung setzen. Die gesamte Obere Altstadt gewinnt so an Bedeutung und Anziehungskraft. Alle diese zum Gesamtprojekt gebündelten Verbesserungen ergeben für die Stadt Bern eine vielversprechende Perspektive.
Nein, die Angebote ergänzen sich. Das Profil von Stadt und Kanton Bern wird durch das Dreieck Kunstmeile Hodlerstrasse, Zentrum Paul Klee und das Museumsquartier beim Helvetiaplatz gestärkt. Das Kunstmuseum strebt eine Zusammenarbeit mit dem Museumsquartier an, insbesondere im Marketing, sowie gemeinsame Projekte im Bereich der Kunst- und Kulturvermittlung. Ebenso ist wie bisher eine enge gegenseitige Unterstützung mit Leihgaben möglich. Die Weiterentwicklung von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee im Zusammenspiel mit dem Aufbau des Museumsquartiers ist eine grosse Chance für Bern, sich auch international als Kultur- und Museumsort zu profilieren.
Der Zeitplan
Das Museum bleibt voraussichtlich von 2029 bis 2033 geschlossen, je nach Beginn der Bauarbeiten.
Während der Schliessung des Museums im Zuge der Bauarbeiten sind in den Jahren 2029 bis 2033 Ausstellungen und Koproduktionen mit einer Reihe von Kunsthäusern im Kanton Bern angedacht. Zum Beispiel wird es eine enge Zusammenarbeit mit dem Schloss Spiez geben, in deren Ausstellungsräumlichkeiten wichtige Konvolute der Sammlung Schweizer Kunst des 19. Jahrhunderts gezeigt werden können. Viele Meisterwerke des Museums, die normalerweise nicht reisen, können in neuen Gegenüberstellungen oder ungewöhnlichen Begegnungen erlebt werden. Dazu kommt ein spielerisches Angebot, das neue digitale Zugänge zur Sammlung schafft.
Neue Hodlerstrasse
Wichtiger Bestandteil der geplanten Erneuerung des Kunstmuseums ist die Aufwertung der öffentlichen Raums an der Hodlerstrasse durch die Stadt Bern. Diese soll sowohl für Museumsbesucher:innen wie auch für die Bevölkerung zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden. Dazu gehört nebst baulichen Massnahmen (Verlegung Ausfahrt Metroparking, Neugestaltung Strassenraum) eine massvolle Verkehrsberuhigung.
Dank Pflästerung und starker Begrünung durch eine Baumreihe erhält die Strasse ein völlig neues Gesicht. Optisch wird die Hodlerstrasse die künftig ebenfalls gepflästerten Bären- und Waisenhausplätze fortsetzen und so die Aufenthaltsqualität in diesen zentralen Perimeter der Oberen Altstadt stark verbessern. Für die Bevölkerung entsteht auf diese Weise ein attraktiver belebter Raum mitten in der Stadt, der für alle zugänglich ist und wo man sich wohl fühlt.
Die Planung des Verkehrsregimes und die Aufwertung des öffentlichen Raums an der Hodlerstrasse erfolgt durch die Stadt Bern.
Die Zeit bis zur Realisierung des Ersatzneubaus des Kunstmuseums soll genutzt werden, um im Sinne einer «lernenden Planung» mit einer Begegnungszone Erfahrungen zu sammeln. So lässt sich nach Einschätzung der Beteiligten sicherstellen, dass nach der Realisierung des Museumsneubaus die bestmögliche und allen Interessen gerecht werdende Lösung umgesetzt werden kann, sich also eine Lösung finden lässt, die den Interessen des Museums, der Stadt und der breiten Bevölkerung ebenso entspricht wie jenen des Gewerbes und der Quartiere.
Gemäss bisherigem Stand sollte die Verkehrsberuhigung durch eine temporäre Sperrung der Hodlerstrasse für den motorisierten Individualverkehr ausserhalb der Hauptverkehrszeiten erreicht werden, wobei die genauen Modalitäten in der weiteren Planung zu justieren sind. Vertiefte Abklärungen zeigen, dass mit einer solchen Lösung – je nach konkreter Ausgestaltung – nicht zu unterschätzende Nachteile verbunden wären (z.B. Mehrverkehr in den Quartieren, fehlende Wendemöglichkeit bei physischer Sperrung) und die erforderliche Aufwertung der strassenseitigen Museumsumgebung auch mit anderen Massnahmen erreicht werden kann. Im Vordergrund dieser Überlegungen steht gegenwärtig die Idee einer attraktiven Begegnungszone, die abgestimmt auf den Museumsneubau und die Sanierung von Bären- /Waisenhausplatz gestaltet wird.
Auf Parkierungsflächen für den motorisierten Individualverkehr im Vorraum des Kunstmuseums soll grösstenteils verzichtet werden. Die Parkplatz- und Anliefersituation wird im Rahmen der Detailplanung vertieft analysiert. Wichtig wird sein, die Interessen des Wirtschaftsverkehrs zu berücksichtigen.
Nur mit der Verlegung der Ausfahrt des Metro-Parking und einem neuen Verkehrsregime lässt sich die Hodlerstrasse im gewünschten Mass aufwerten und beleben. Die Verlegung ist notwendig, um vor dem Eingangsbereich beim Ersatzneubau einen öffentlichen Platz zu schaffen und den Zugang u.a. für Fussgänger:innen und Velofahrer:innen zum Kunstmuseum zu erleichtern. Vertiefte Abklärungen bestätigen, dass die Verlegung der Metro-Ausfahrt aus baulicher Sicht machbar ist. Die Ausfahrt wird neu dort angeordnet, wo sich heute die Einfahrt befindet. Diese Anordnung ermöglicht die Wegfahrt aus dem Parking in Richtung Untere Altstadt; zugleich kann die alte Rampe in der Hodlerstrasse aufgehoben werden.